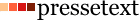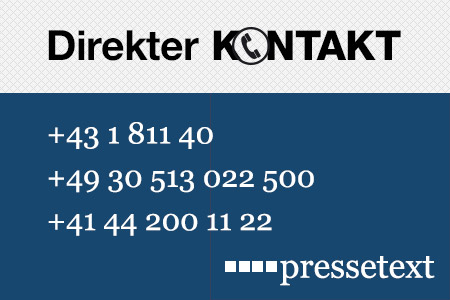Sonde spürt Krankheitserreger auf
Molekulare Sonden zur Probenentnahme bei Bakterien eingesetzt
Würzburg (pte) (pte010/13.01.2000/11:00) Die Existenz von Krankheitserregern wird dem Menschen meistens erst dann so richtig bewusst, wenn er sich eine Infektion geholt hat. Doch die Erreger sind allgegenwärtig - sie bevölkern Luft, Boden und Wasser. Der Nachweis dieser Mikroorganismen steht im Mittelpunkt eines Forschungsprojektes des Instituts für Molekulare Infektionsbiologie der Universität Würzburg. http://www.uni-wuerzburg.de/
Wie groß ist die Gefahr, die von den Krankheitserregern in der Umwelt ausgeht? Wer sich mit dieser Frage befasst, kommt nicht umhin, die Vermehrungsfähigkeit der Erreger zu untersuchen. Gerade bei krankmachenden Mikroorganismen, die sich schnell fortpflanzen, ist die Verbreitung im Wasser als kritischer Faktor anzusehen. Aber die ökologischen Daten zum Verhalten von Infektionserregern in Oberflächengewässern, im Grundwasser und im Abwasser sind mangelhaft. Um diese Wissenslücken beseitigen zu können, müssen Nachweistechniken für die jeweiligen Mikroorganismen, für ihre Erbsubstanz DNA und für ihre Genaktivitäten eingesetzt werden.
Prof. Dr. Jörg Hacker von der Universität Würzburg und seine Mitarbeiter Dr. Michael Steinert und Diplom-Biologin Dorothee Grimm setzten kurze molekulare Sonden ein, die sich an die so genannte 16S-ribosomale RNA der Bakterien binden. Die Sonden werden in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Karl-Heinz Schleifer von der Technischen Universität München http://www.tu-muenchen.de/ speziell für bestimmte Erreger konstruiert. Sie können direkt in den aus der Umwelt entnommenen Proben eingesetzt werden; eine vorherige Anzüchtung der Bakterien im Labor ist nicht notwendig. Darüber hinaus können mit entsprechenden Techniken auch die Wirtszellen von Krankheitserregern identifiziert werden: Die Erreger der Legionärskrankheit beispielsweise leben im Inneren von Amöben.
Viel versprechen sich die Würzburger Wissenschaftler auch von einer Weiterentwicklung dieser Sondentechnik, den Transkriptionssonden: Diese docken in den Bakterien an die Botenmoleküle an, welche die Erbinformation zum Ort der Proteinsynthese bringen. Auf diese Weise lassen sich die Genaktivitäten der Bakterien nachweisen. Durch die Kombination der beiden Sonden ist es zudem möglich, gleichzeitig die Struktur und Funktion von Mikroorganismen in komplexen Lebensgemeinschaften zu analysieren.
Die Anwendungsgebiete für diese Forschungen finden sich in den Bereichen Medizin, Biotechnologie, Landwirtschaft, Abwasserbehandlung und Altlastensanierung. Bei den geplanten Untersuchungen stehen vor allem Bakterien im Mittelpunkt, die bei in Bayern laufenden gentechnischen Arbeiten als Empfängerorganismen verwendet werden. Informationen: Dr. Michael Steinert, E-Mail: michael.steinert@mail.uni-wuerzburg.de (idw)
(Ende)| Aussender: | pressetext.austria |
| Ansprechpartner: | rh |
| Tel.: | 01/406 15 22-0 |
| E-Mail: | redaktion@pressetext.at |
| Website: | pressetext.at |