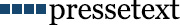Siliziumbasierter Laser rückt in Sichtweite
THz-Lichtemission von Quantenstrukturen des n-Typs aus Germanium und Silizium nachgewiesen
Frankfurt an der Oder (pte025/22.03.2021/12:30) Forschern des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik (IHP) http://www.ihp-microelectronics.com ist eigenen Angaben nach ein Meilenstein auf dem Weg zum siliziumbasierten Laser gelungen. Sie haben erstmals die THz-Lichtemission von Quantenstrukturen des n-Typs aus Germanium und Silizium nachgewiesen, das am häufigsten verwendete Material elektronischer Geräte.
Keine Ionisierung
"Dieses Ergebnis ist der erste realistische Ansatz zur Realisierung eines neuartigen Quantenkaskadenlasers für die THz-Lichtemission, der vollständig hergestellt und mit den Fertigungsverfahren üblicher mikroelektronischer Bauelemente zu geringen Kosten erzielt werden kann", sagt Monica De Seta vom Wissenschaftsministerium der Universität Roma Tre, die das Konsortium des europäischen Projekts FLASH koordiniert.
Die Lichtenergie liegt zwischen der von Mikrowellen und Infrarot und weist besondere Merkmale auf, wie zum Beispiel die Fähigkeit, durch viele im sichtbaren Bereich undurchsichtige Materialien wie Papier und Stoffe zu dringen, nicht zu ionisieren, lebendige Materie nicht zu beschädigen sowie das Leben nicht zu schädigen. Darüber hinaus macht die Tatsache, dass viele biologische Moleküle und chemische Verbindungen komplexer Materialien wie Sprengstoffe und Arzneimittel in diesem Spektralbereich einzigartige "Fingerabdrücke" besitzen, THz-Licht aus anwendungsbezogener Sicht interessant.
Defekte reduziert
"Dieses wichtige Ergebnis konnte durch die Fortschritte, die wir bei der Steuerung der Abscheidung der dem Gerät zugrunde liegenden Quatenstrukturen erzielt haben, erreicht werden. In der Praxis war es notwendig, Hunderte von Schichten unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung, die nur wenige Milliardstel Meter dick waren mit Kontrolle auf der Ebene der einzelnen Atomschicht, zu wechseln. Darüber hinaus konnten wir die Defekte reduzieren, die sich bei so dicken Strukturen auf natürliche Weise bilden", bemerkt Giovanni Capellini, der für die Materialcharakterisierung verantwortlich ist und das Projekt am IHP leitet.
(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |
| Ansprechpartner: | Florian Fügemann |
| Tel.: | +43-1-81140-313 |
| E-Mail: | fuegemann@pressetext.com |
| Website: | www.pressetext.com |