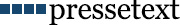3D-Druck: Spannungen im Material vermeidbar
Zeitlicher Eintrag von Wärme bei Produktion ist beim Aufbau der einzelnen Schichten entscheidend
München (pte026/26.04.2021/12:00) Forscher können an der Technischen Universität München (TUM) http://tum.de die inneren Spannungen von Gasturbinenschaufeln, die per 3D-Druck hergestellt wurden, zerstörungsfrei bestimmen. Beim Laser-Pulverbett-Schmelzverfahren wird das pulverförmige Ausgangsmaterial durch selektives Aufschmelzen mit einem Laser Schicht für Schicht aufgebaut. Doch durch den sehr lokalen Wärmeeintrag des Lasers und die schnelle Abkühlung der Schmelze entstehen auch Spannungen im Material.
Verformungen und Risse
Die Hersteller eliminieren diese Spannungen zwar in einem nachgeschalteten Wärmebehandlungsschritt. Doch das kostet Zeit und damit Geld. Die Spannungen können auch schon während des Aufbaus und bis zur Nachbehandlung Schäden im Bauteil anrichten. "Sie können zu Verformungen und schlimmstenfalls zu Rissen führen", sagt Tobias Fritsch von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) http://bam.de .
Konkret hat der BAM-Forscher ein additiv gefertigtes Bauteil des Gasturbinenherstellers Siemens Energy in der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) mit Neutronen auf Eigenspannungen untersucht. Für das Neutronen-Experiment am FRM II hat Siemens Energy eine wenige Millimeter große Gitterstruktur aus einer für Gasturbinenkomponenten üblichen Nickel-Chrom-Legierung ausgedruckt. Die übliche Wärmebehandlung nach der Fertigung wurde dabei absichtlich weggelassen.
Eine Sache der Parameter
Nachdem Eigenspannungen nachgewiesen wurden, sollten die zerstörerischen Spannungen verringert werden. "Wir wissen, dass wir die Parameter des Bauprozesses und damit den Aufbau des Bauteils anpassen müssen", weiß Fritsch. Dabei sei der zeitliche Wärmeeintrag beim Aufbau der einzelnen Schichten entscheidend. "Je lokaler wir die Wärme beim Schmelzen des Pulvers einbringen, desto mehr Eigenspannungen erzeugen wir."
Der Erkenntnisgewinn: Je länger der Laser des Druckers auf einen Punkt gerichtet ist, desto stärker erwärmt sich dieser im Vergleich zu den Nachbarbereichen. Dies erzeugt Temperaturgradienten, die zu Unregelmäßigkeiten im Atomgitter führen. "Wir müssen die Wärme beim Drucken also möglichst gleichmäßig verteilen", so Fritsch. Zusammen mit Siemens seien bereits neue Messungen an der TUM-Neutronenquelle in Garching geplant.
(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |
| Ansprechpartner: | Florian Fügemann |
| Tel.: | +43-1-81140-313 |
| E-Mail: | fuegemann@pressetext.com |
| Website: | www.pressetext.com |