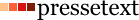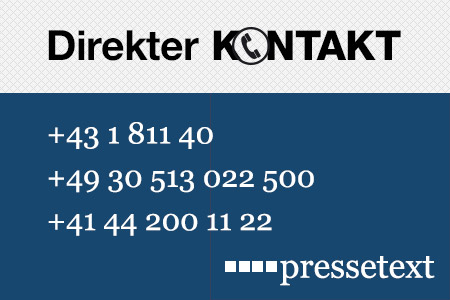Rosenkrieg bei Vögeln durch fremde Weibchen ausgelöst
Ornithologen untersuchen Trennungsverhalten bei Blaumeisen
 |
Auch die monogamen Blaumeisen wechseln gern den Partner (Foto: pixelio.de - Hanspeter Bolliger) |
Seewiesen (pte028/24.04.2008/13:45) Nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Vögeln sind Scheidungen offenbar gang und gäbe. Die Verhaltenökologen Bart Kempenaers und Mihaj Vicu vom Max-Planck-Institut für Ornithologie http://www.orn.mpg.de haben in einer Langzeitstudie mit Blaumeisen belegen können, dass auch bei sozial monogamen Vögeln Fremdgehen verbreitet ist. Dabei konnten sie Trennungsraten von 53 Prozent beobachten. Für die beiden Wissenschaftler galt es nun herauszufinden, welcher der beiden Partner eher von der Trennung profitiert.
Frühere Studien hatten ergeben, dass oftmals die weiblichen Sperlingsvögel, zu denen auch die Blaumeisen zählen, den größeren Nutzen aus einer "Scheidung" ziehen. So hätten sie mit dem neuen Partner mehr überlebensfähige Nachkommen gezeugt. "Nach diesen Erkenntnissen sollten es die Weibchen sein, welche die Initiative zum Verlassen eines Partners ergreifen", erklärt Kempenaers, Direktor der Abteilung für Verhaltenökologie und Evolutionäre Genetik am Max-Planck-Institut für Ornithologie.
Kempenaers und sein Mitarbeiter Mihaij fanden allerdings heraus, dass sich der bessere Bruterfolg nicht allein durch die Trennung vom alten Partner begründen lässt, sondern vielmehr mit dem daraus folgenden Ortswechsel zusammenhängen würde. Die Wissenschaftler verzeichneten nur bei denjenigen Weibchen einen Anstieg der Nachkommenschaft, die ihr angestammtes Territorium verlassen und sich an einem besseren Platz wieder niedergelassen hatten. Die männlichen Blaumeisen dagegen hätten sich generell als Nesthocker erwiesen und seien nach der Trennung in ihrer gewohnten Umgebung geblieben.
Daraufhin haben die Forscher die Blaumeisenweibchen genauer untersucht, die nach Ende der Beziehung an ihrem angestammten Nistplatz oder zumindest in dessen Nähe verblieben waren. Sie erhofften sich dadurch den Effekt des Territoriumswechsels von dem der Scheidung entkoppeln zu können. Dabei stellte sich heraus, dass entgegen der vorherigen Ergebnisse der Langzeitstudie hier nicht die Weibchen, sondern vielmehr die Männchen die Trennungsprofiteure waren: Durch die Paarung mit größeren Weibchen hatten sie einen höheren Bruterfolg, als mit ihren ehemaligen Partnerinnen.
Über den endgültigen Scheidungsverursacher könne man also weiter nur spekulieren, so Kempenaers. "Aber unsere Hypothese ist, dass ein größeres, stärkeres Weibchen die ursprüngliche Partnerin vertreibt und das Männchen samt Territorium übernimmt." Damit wäre der sehr menschliche Kampf der Weibchen um einen guten Paarungspartner der Auslöser für Trennungen in der Vogelwelt.
(Ende)| Aussender: | pressetext.austria |
| Ansprechpartner: | Claudia Misch |
| Tel.: | +43-1-81140-316 |
| E-Mail: | misch@pressetext.com |