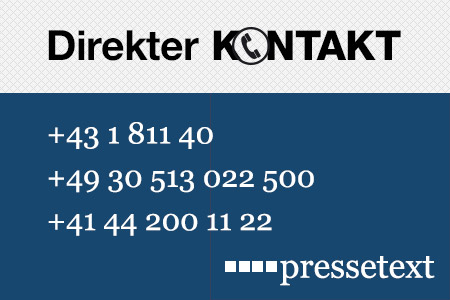Revolution in der Augenchirurgie
Große Erfolge mit neuen Methoden und Instrumenten
Wien (pts008/05.02.1999/10:00) Mit neuen Methoden wie der Iris Claw Lense (ICL), der Multifokalen Linse (MFL), der Teledioptrischen Linse (TDL) und der Refraktiven Rotationskeratoplastik (RRK) konnte das Instrumentarium der Augenchirurgie in letzter Zeit deutlich ausgebaut und verbessert werden. Der Innsbrucker Augenspezialist, Univ.Prof. Dr. Mathias Zirm, erklärt im folgenden die Anwendbarkeit und Einsatzmöglichkeiten der neuen Methoden.
Teledioptrische Linse (TDL) - "Fernrohr-Effekt" für praktisch Blinde
Mit der Teledioptrischen Linse (TDL) werden Patienten behandelt, die kein Lesevermögen mehr aufweisen (auch nicht mit einer Lupe), die also praktisch blind sind. Der Grund für diese Augenerkrankung liegt in einer Veränderung der Macula (der Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut), die sich für die Betroffenen in einem ständigen schwarzen Fleck im Sichtfeld äußert.
Die Teledioptrische Linse funktioniert wie eine starke Kontaktlinse von -50 Dioptrien, kombiniert mit einer Brille von +45 Dioptrien, wodurch ein "Fernrohr-Effekt" ermöglich wird. Das heißt, die behandelten Patienten können dann in geringer Nähe eine Sehleistung von 50 - 60 Prozent erreichen. Die TDL ist eine intraokulare Linse und wird in den Kapselsack des Auges eingepflanzt. In Österreich ist die TDL-Methode seit August 1998 im praktischen Einsatz und wird derzeit ausschließlich von Univ.-Prof. Dr. Zirm in Innsbruck angewandt. Die Patienten sind vor allem ältere Menschen.
Multifokale Linse (MFL) - Bei Staroperationen
Die Multifokale Linse wird bei Staroperationen angewendet. Diese intraokulare Linse, die einen Nahzusatz von +3,5 Dioptrien hat, wird in den Kapselsack eingesetzt und kann in Kombination mit einer Lesebrille auch bei Netzhautdegeneration helfen. Vor allem bei Staroperationen an nur einem Auge bei jungen Menschen ist die Multifokale Linse ein geeignetes Mittel zur Korrektur. Die MFL wird von Prof. Zirm seit April 1998 in Innsbruck verwendet und zeigt gute Ergebnisse in der Anwendung. Weltweit wurde die Linse bisher bei über 50.000 Operationen eingesetzt.
Iris Claw Lense (ICL) - Bei hoher Fehlsichtigkeit
Die Iris Claw Lense (ICL) wird zur Korrektur hoher Fehlsichtigkeiten eingesetzt. Ihr Anwendungsgebiet reicht von -15 bis -25 Dioptrien Kurzsichtigkeit und von +6 bis +12 Dioptrien Weitsichtigkeit (zwischen -15 und +6 Dioptrien wird die LASIK-Methode angewendet). Bei der Operation wird die künstliche Linse zusätzlich zur körpereigenen Linse (vor der Regenbogenhaut) auf der Iris im Augeninneren eingesetzt. Der Eingriff erfolgt ambulant, das Auge wird mit Augentropfen betäubt, und die eigentliche Operation dauert ca. 20 Minuten. Danach kann der Patient wieder nachhause gehen, nur noch Kontrollen sind notwendig.
Univ.-Prof. Dr. Mathias Zirm, der diese Methode als erster und bis dato einziger Augenchirurg in Österreich anwendet, setzt die ICL auch in Kombination mit der LASIK-Chirurgie ein, da auf diesem Wege sehr hohe Myopien (Kurzsichtigkeit) und Hyperopien (Weitsichtigkeit) korrigiert werden können.
Refraktive Rotationskeratoplastik (RRK) - Bei Hornhautschäden
Die sogenannte "Refraktive Rotationskeratoplastik" (RRK) wurde von Prof. Zirm im Sanatorium Hochrum bei Innsbruck entwickelt und seit 1996 erfolgreich eingesetzt. Der für den Patienten schmerzfreie Eingriff erfolgt ambulant bei lokaler Betäubung und dauert ungefähr eine halbe Stunde, danach kann der Patient das Sanatorium wieder verlassen.
"Das Prinzip der Refraktiven Rotationskeratoplastik ist ganz einfach", erläutert der Augenchirurg: "Durch die Drehung eines Hornhautscheibchens können Schäden wie Hornhauttrübungen, Narben oder optische Fehler aus dem Zentrum der Hornhaut in die Peripherie 'weggedreht' werden, wo sie nicht mehr stören und damit die Sehkraft nicht mehr beeinträchtigen." So kann dem Patienten in manchen Fällen sogar eine aufwendige und risikoreiche Hornhauttransplantation erspart werden.
Vor dem Eingriff wird die Hornhaut des Patienten analysiert und die Operation im Computer simuliert. Mit Hilfe eines "Hornhauthobels" (Corneal Shaper) wird dann ein entsprechendes Hornhautläppchen abgetrennt und in die richtige Position gedreht. Dieser Corneal Shaper wurde ursprünglich für die LASIK-Chirurgie zur operativen Behandlung von Fehlsichtigkeit entwickelt und dort seit langem erfolgreich eingesetzt. Nach der Drehung wird der Sitz des Läppchens kontrolliert und zur Stabilisierung noch einige Tage mit einer Kontaktlinse bedeckt.
LASIK - International erfolgreichste Methode gegen Fehlsichtigkeit
Bei der "Laser in situ Keratomileusis"-Methode (LASIK) wird mit einem sogenannten "lamellierenden Schnitt" ein Läppchen an der Hornhautoberfläche eingeschnitten. An der nasalen Seite behält dieses Läppchen ("flap") eine Verbindung zur Hornhaut, an der es wie ein Türflügel umgeklappt werden kann. Anschließend wird mit dem Laser eine genau berechnete Scheibe in der Hornhautmitte abgedampft. Durch diese Veränderung der Hornhaut wird die Brechkraft des Auges korrigiert. Zum Schluß wird der auf die Seite geklappte "flap" wieder zurückgelegt.
Mit Hilfe der LASIK-Technik können sowohl Kurz- und Weitsichtigkeit, als auch Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) korrigiert werden. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von +8 Dioptrien Weitsichtigkeit bzw. -20 Dioptrien Kurzsichtigkeit bis zu 6 Dioptrien Astigmatismus. Ein großer Vorteil der Methode ist auch die völlige Schmerzlosigkeit, selbst nach der Operation treten keine Schmerzen auf. Prof. Zirm gilt in Österreich als LASIK-Pionier; mehr als 3000 Operationen wurden seit 1996 von ihm durchgeführt.
Informationen: Univ.Prof. Dr. Mathias Zirm, Fallmerayerstraße 3, 6020 Innsbruck, Tel. 0512/581860, Fax: 0512/581860-1, E-Mail: office@zirm.net
(Ende)| Aussender: | Augenzentrum Prof. Zirm GmbH |
| Ansprechpartner: | Mag. Jochen Noack |
| Tel.: | 01/402 48 51 |
| E-Mail: | noack@temmel-seywald.at |
| Website: | www.zirm.net |