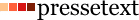Uwe Hasebrink rundet Hedy-Lamarr-Lectures 2011 ab
Vorlesung erforscht Frage der Mediennutzung der Zukunft
Wien (pte021/08.11.2011/13:35) Gestern, Montag, fanden in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAK) die Hedy-Lamarr-Lectures 2011 ihren Abschluss. Der letzte Teil der von der Telekom Austria http://telekomaustria.com , der ÖAK und dem Medienhaus Wien initiierten Vortragsreihe beschäftigte sich mit der zukünftigen Verwendung von Medien. Nach Einleitung von Daniela Kraus, Medienhaus Wien, und Elisabeth Mattes, Konzernsprecherin der TA, sprach der renommierte Kommunikationswissenschafter Uwe Hasebrink vom Hamburger Hans-Bredow-Institut http://hans-bredow-institut.de zum Thema "Mediennutzung in konvergierenden Medienumgebungen".
Nutzerperspektive ist am wichtigsten
"Die Mediennutzungsforschung wird vernachlässigt, dabei war sie noch nie so wichtig wie heute", betonte Hasebrink schon zu Beginn seiner Vorlesung, die sich der Frage widmete, wie Medien in Zukunft genutzt werden und welche Rolle die Rezipienten einnehmen.
Der Wissenschafter präsentierte seine Erkenntnisse vor allem aus der Perspektive des Mediennutzers, da diese in einem sich stetig wandelnden und dynamischer werdenden Umfeld die wichtigste sei. "Was Menschen in einer konvergierenden Medienumgebung tun, ist nur aus dieser Betrachtungsweise zu erkennen und nicht aus technischer Perspektive."
Inhalt versus Reichweite
Die Grundfrage wurde über vier Eckpunkte erforscht. So wurde zuerst die Rolle der Medienkonsumenten erörtert, um zu verstehen, aus welcher Perspektive die Qualität eines Mediums beurteilt werden kann. Dabei warf Hasebrink auch die stetig aktuelle Debatte über den Zusammenhang zwischen Reichweite und inhaltlicher Gestaltung auf.
Bedeutend für die weiteren Ausführungen war die Erörterung von Medienrepertoires, die Art und Weise wie Nutzer verschiedene Medien miteinander im zeitlichen und biographischen Verlauf kombinieren.
Verschwimmende Grenzen
Dies ging Hand in Hand mit der Analyse von den Kommunikationsmodi der Rezipienten. Hier erwies sich als wesentlicher Punkt, dass die technische Ausstattung für den Konsum von Medien zumindest im technologisierten Westen bei der Erforschung der Mediennutzung immer weniger Bedeutung zukommt. Dies liegt unter anderem daran, dass viele Geräte - vom Handy bis zum TV-Gerät - immer ausgereiftere und ähnliche Zugangsmodi bieten.
In der Hinsicht wurde auch die Diskussion um die Unterscheidung von Medienformen und die Sinnhaftigkeit einer solchen in Angriff genommen. So stellte Hasebrink etwa die Frage, ob der Konsum der Aufzeichnung der ARD Tagesschau nach der Ausstrahlung originär dem Fernsehen oder Internet zugerechnet werden kann und soll. Das Verschwimmen der Grenzen zwischen den Medienformen sowie zwischen privater und öffentlicher Kommunikation durch das Social Web erfordern hier die Beschreitung neuer Wege in der Wissenschaft.
Schließlich sprach Hasebrink über die Bindungen, die die Nutzer als Konsumenten und Bürger gleichermaßen mit Medienangeboten eingehen werden. Hier unterschied er zwischen zeitlichen, räumlichen, inhaltlichen und sozialen Verknüpfungen, die ausschlaggebend für den Medienkonsum sein werden.
Neue Mediatoren gewinnen an Einfluss
Abschließend forderte er einen wissenschaftlich breiteren Zugang zur Mediennutzung, die derzeit fast ausschließlich in der Publikumsforschung beheimatet ist. Sein Fazit umfasst die Deutung der Nutzer nicht nur als Konsumenten, sondern auch als Bürger und Rechteinhaber, die ihr Medienrepertoire aus alten und neuen Medien kombinieren.
Da in Zukunft der Konsum aller Medienformen jederzeit möglich ist, folgerte der Forscher, dass infolge der Irrelevanz gerätebezogener Klassifikationen vor allem die Gebrauchsweisen der Nutzer maßgeblich werden. Deren Bindungen wiederum werden von neuen Mediatoren beeinflusst, darunter etwa Internetriesen wie Google, deren Suchalgorithmen maßgeblichen Einfluss auf den Konsum von Information im Netz haben, aber auch Plattformen wie Facebook, die mitunter als Empfehlungsnetzwerke fungieren.
Fortsetzung folgt
Die Vortragsreihe ist benannt nach Hedwig Eva Maria Kiesler, später Hedy Lamarr, einer austro-amerikanischen Schauspielerin und Erfinderin. Die einst von Max Reinhardt als "schönste Frau Europas" titulierte Künstlerin errang Berühmtheit in der Frühzeit des deutschen Filmes und arbeitete an der Seite von damaligen Stars wie Heinz Rühmann und Hans Moser. Sie floh 1937 aus Deutschland und glänzte in den 40er-Jahren als Hollywood-Star. Sie starb am 19. Januar 2000 im Alter von 86 Jahren in Casselberry, Florida. Seitens der Telekom Austria wurde für 2012 bereits eine Fortsetzung der Hedy-Lamarr-Lectures angekündigt.
Fotos zur Veranstaltung stehen unter
http://fotodienst.pressetext.com/album/2855 als Download zur Verfügung.
| Aussender: | pressetext.redaktion |
| Ansprechpartner: | Georg Pichler |
| Tel.: | +43-1-81140-303 |
| E-Mail: | pichler@pressetext.at |
| Website: | www.pressetext.com |