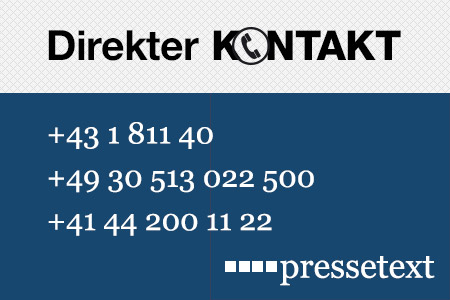Österreichische Forscher wollen Ausbreitung der Wüste eindämmen
Internationales Kooperationsprojekt für bessere Lebensbedingungen in chinesischer Oase
Wien (pte) (pts008/30.01.2000/11:00) Wissenschaftler vom Wiener Institut für Ökologie und Naturschutz versuchen im Rahmen eines internationalen Kooperationsprojekts, die Lebensbedingungen in einer chinesischen Oase verbessern. Das Ziel ist, die Ausbreitung der Wüste einzudämmen und die Feldwirtschaft der Oase zu sichern. Gefördert wird das Projekt im Rahmen des EU-Programmes INCO-DEV (Forschungszusammenarbeit mit Entwicklungsländern), in dem im März eine neue Ausschreibungsrunde beginnt.
Seit einem Jahr beschäftigt sich das Projekt "Management von Wüstenrandvegetation" mit der Erforschung der Pflanzenwelt im Randbereich einer Oase der chinesischen Taklamakan Wüste. Die Wiener Biologen Prof. Marianne Popp und Mag. Stefan Arndt vom Wiener Institut für Ökologie und Naturschutz (vormals Institut für Pflanzenphysiologie) http://www.univie.ac.at/pph hat es in eine der trockensten Gegenden der Welt verschlagen: die Taklamakan Wüste im Westen Chinas. Diese zweitgrößte Sandwüste der Welt ist die klimatisch extremste Wüste Zentralasiens - nur 30 mm Niederschlag fallen im Jahr auf den feinen Sandboden. Dennoch hat sich am Südrand der Taklamakan entlang der Seidenstraße seit Jahrhunderten eine Oasenkultur etabliert, die inzwischen eine der wichtigsten Kornkammern Westchinas darstellt. Schmelzwässer aus dem südlich gelegenen mächtigen Kunlun-Gebirge ermöglichen eine Bewässerungs-Landwirtschaft auf dem an sich sehr fruchtbaren Löss.
Die Oasen werden vor der sich ausbreitenden Wüste durch einen breiten natürlichen Vegetationsgürtel geschützt, der für die Bevölkerung zudem eine wichtige Quelle für Viehfutter und Brennholz darstellt. Durch die Ausweitung der Anbauflächen und den zunehmenden Bevölkerungsdruck - in der Oase Qira leben beispielsweise 130.000 Menschen - wird dieser Schutzgürtel in zunehmenden Maße beansprucht. Überweidung und Übernutzung der Vegetation haben zur Folge, dass an vielen Stellen der Schutzgürtel zerstört wurde und die Wüste sich ungehindert in die Oasen ausdehnen kann.
An diesem Problem setzen die Wiener Ökologen in Zusammenarbeit mit Kollegen der Universität Göttingen http://www.uni-goettingen.de und drei chinesischen Instituten an. Prof. Popp: "Wir müssen verstehen, wie sich die Pflanzen an die extremen klimatischen Bedingungen anpassen und wie sie ihr Überleben sichern. Nur so können wir Empfehlungen geben, wie die Wüstenrandvegetation genutzt werden kann, ohne dass sie zerstört wird."
Die Forscher wollen die ökologischen Grundlagen für eine nachhaltige Nutzung der Schutzvegetation erarbeiten, auch die Bedürfnisse der einheimischen Uiguren werden untersucht. Die Nutzungsempfehlungen lassen sich nicht ohne die Einbindung der Bevölkerung in die Tat umsetzen, da die Bewohner der Oasen die Pflanzen der Wüste auf jeden Fall nutzen werden.
Doch die Arbeiten des deutsch-österreichisch-chinesischen Forscherverbundes stehen erst am Anfang. Auf ausgewählten Versuchsflächen werden die wichtigsten einheimischen Wüstenarten untersucht, ihr Wachstum nach verschiedenen Nutzungsvarianten beobachtet und ihre Resistenz gegen Trockenheit studiert. Erste Ergebnisse werden Mitte nächsten Jahres erwartet. Die Wiener sind zuversichtlich. Prof. Popp: "Die Zusammenarbeit klappt hervorragend und bisher sind alle Mitarbeiter wieder zurückgekehrt..." Taklamakan, der Name der Wüste, bedeutet nämlich wörtlich: "Aus der du nicht heimkommst". http://www.bit.ac.at/welcome_nojava.htm
Projekte wie jenes in der Taklamakan-Wüste werden im Rahmen des EU-Programmes INCO-DEV gefördert. Für 15. März 2000 ist die nächste Ausschreibung in diesem Programm geplant (für Projekte in Afrika, Karibik, Pazific, Asien, Latein Amerika und den Mittelmeerpartnerstaaten). Diese Ausschreibung soll für Projekte auf Kostenteilungsbasis (so genannte Shared Cost-Projects), konzertierte Aktionen (sogenannte "Concerted Actions") und Thematische Netzwerke gelten, wobei ein Budget von 80 Mio. EURO veranschlagt ist.
(Ende)| Aussender: | ITTI: Informationstransfer für neue Technologien und Innovationen |
| Ansprechpartner: | Georg Panovsky |
| Tel.: | 01-4061522-46 |
| E-Mail: | panovsky@pressetext.at |
| Website: | www.fff.co.at/ |