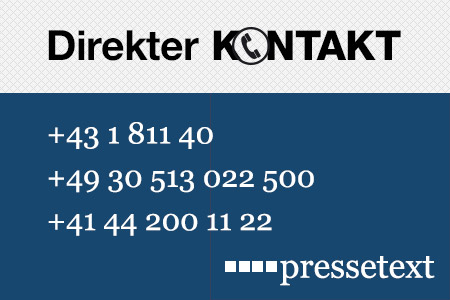Schlossmuseum Arnstadt - Zwischen Hofetikette und Jahrmarktstreiben
Leben im 18. Jahrhundert in Miniatur und Original
Arnstadt (pts016/21.05.2010/12:00) Die barocke Puppenstadt "Mon plaisir"
Der vom Äußeren streng rationalistische Bau des Neuen Palais, als Witwensitz der Fürstgemahlin Elisabeth Albertine von Schwarzburg-Sondershausen 1729-1734 erbaut, birgt ein kunsthistorisches Kleinod in seinen Mauern: die barocke Puppenstadt "Mon plaisir". Mit ihr verbindet sich der Name einer weiteren Frauengestalt des schwarzburgischen Hofes in Arnstadt, Auguste Dorothea. Die verwitwete kinderlose Fürstin fand neben ihrer ausgeprägten Sammelleidenschaft ihr "plaisir" - ihr Vergnügen - in der Fertigung dieser einzigartigen Miniaturwelt. Diese repräsentativen Kunstkammerobjekte waren nie zum Spielen gedacht, sondern zeigen bühnengleich Abbilder der verschiedenen Lebenswelten einer kleinen Residenzstadt. Dreidimensionalen barocken Genrebildern ähnelnd, entführen die einzelnen Stuben in die Intimität der fürstlichen Wohn- und Repräsentationsräume mit ihrem typischen Interieur, lenken den Blick auf die kleinbürgerliche Seite des Lebens mit Handel und Handwerk und zeigen ebenso klösterliche Gefilde.
Die einzelnen Darstellungen bilden eine kleine heile Welt und trotzdem einen getreuen Spiegel des Lebens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. So kann man z.B. die verschiedensten Handwerksberufe mit den vielen, für die damalige Zeit typischen Handwerks- und Gebrauchsgegenständen finden: den Schreiner, den Drechsler, den Weber, den Böttcher, den Schlächter u.a.m. Im höfischen Bereich ergänzen der Schneider, der Friseur und der Küfer das Bild. Auf dem Jahrmarkt tummelt sich allerlei Volk: Wachszieher und Scherenschleifer, Händler unterschiedlichster Couleur preisen ihre Waren an, Bürgersfrauen wandeln von Stand zu Stand, und auch eine kleine Schauspieltruppe mit Komödianten darf nicht fehlen.
Ein Philosoph meditiert neben einem Totenschädel, Damen und Herren sitzen am Teetisch, musizieren oder spielen Karten, Kutschen und Pferde zeugen vom Reiseverkehr der damaligen Zeit. In der Hofküche herrscht unter den mit blitzenden Geräten und diversen Keramiken gefüllten Regalen geschäftiges Treiben. Die kleinen Figuren mit den aus Wachs modellierten Köpfen agieren in der reich geschmückten Kleidung des Barock an den verschiedensten Schauplätzen; sie sind der lebendige Mittelpunkt eines jeden Bildes.
Das Porzellankabinett, in welchem der Fürst und ein anderer Vornehmer sich zwischen den auf Konsolen präsentierten Stücken aufhalten, fasziniert durch die reiche Verzierung der Wände und Deckengesimse und die zarte Bemalung der ausgestellten Porzellane. Es findet sein Pendant im Schloss.
Sammellust und Wohnkultur
Kunst und Kunsthandwerk des 16. bis 18. Jahrhunderts
Das um 1735 fertiggestellte Porzellankabinett im südlichen Seitenflügel präsentiert ebenso wie die faszinierende Miniatur im "Mon plaisir" vor allem wertvolle ostasiatische Porzellane. Außer den rund 1000 Stücken aus China und Japan aus der Zeit von etwa 1680-1730 lassen sich in den angrenzenden Räumen auch frühe Meißner Porzellane sowie Gegenstände aus Böttgersteinzeug bewundern, so z.B. die Büste der Proserpina aus Böttgersteinzeug, die von Benjamin Thomae stammt.
Ein weiteres herausragendes Unikat der kunsthandwerklichen Sammlungen ist ein aus Silber gefertigter und im Ganzen feuervergoldeter "Willkomm" in Form eines Adlers, 1592 von Hans Kellner in Nürnberg gefertigt.
In den fürstlichen Räumen, deren historische Raumfassungen nachempfunden wurden, zeigt das Museum vorzugsweise Dorotheenthaler Fayencen sowie geschnittene Gläser und Pokale aus den Sammlungen des Fürsten Anton Günther II. sowie des Fürsten Günther I. von Schwarzburg-Sondershausen. Bemerkenswert ist auch der Umstand, dass mehrere bemalte Leinwandtapeten (Mitte 18. Jahrhundert) aus dem Haus "Zur güldenen Krone" in Arnstadt in restauriertem Zustand präsentiert werden können, gilt doch diese Örtlichkeit als eine mögliche Wohnstatt Johann Sebastian Bachs während seines Aufenthaltes in Arnstadt.
1727 kam der Maler Johann Alexander Thiele aus Dresden nach Arnstadt. 1729 wurde er hier der Betreuer der Gemäldesammlung sowie Berater des schwarzburgischen Fürstenpaares in Kunstangelegenheiten, bevor er 1739 als Hofmaler nach Dresden zurückkehrte. Das Arnstädter Schlossmuseum kann sieben Thiele-Gemälde sein Eigen nennen, wovon fünf im Bilderkabinett zu bewundern sind.
Bach in Arnstadt
Die Stadt Arnstadt war nicht nur die Wirkungsstätte des jungen Johann Sebastian Bach, sondern auch Heimat seiner Vorfahren. "Die Bache", wie die Mitglieder der Musikerfamilie genannt wurden, breiteten sich vom Ende des 16. Jahrhunderts in ganz Thüringen und darüber hinweg aus und bestimmten das Musikleben in jener Zeit entscheidend mit. Durch vier Generationen kann beinahe lückenlos zurückverfolgt und nachvollzogen werden, wie die männlichen Vertreter der Familie Bach als Türmer und Hausmann, Musikantenjunge, gräflicher Hofmusicus, Organist an den verschiedenen Kirchen, Instrumentalist in der Hofkapelle, Stadtmusikdirektor, Komponist oder als Instrumentenbauer in der ehemaligen Residenzstadt tätig waren.
Fast alle Bache, die hier geboren oder gestorben sind, geheiratet oder gelebt haben, gehörten der Wechmarer Linie - mit Veit Bach als Stammvater - an. Die Verbindung zwischen Arnstadt und den Angehörigen der Musikerfamilie Bach wurde 1620 mit der Übersiedlung von Caspar Bach, dem Älteren, von Gotha nach Arnstadt hergestellt. Sie endete 1739 mit dem Tod von Ernst Bach, dem letzten männlichen Nachkommen in Arnstadt.
Nichtsdestotrotz verbindet sich mit dem Namen "Bachstadt Arnstadt" der Aufenthalt des bekanntesten Vertreters dieser Musikerfamilie in den Mauern unserer Stadt: des jungen Johann Sebastian. Bach, der von 1703 bis 1707 als Organist an der Neuen Kirche - heute Bachkirche - in Arnstadt tätig war, steht deshalb auch im Mittelpunkt der neu gestalteten Ausstellung im Schlossmuseum. Darüber hinaus wird das historische, künstlerische, musikalische und wissenschaftliche Umfeld der Bachzeit beleuchtet. Arnstadt war bis 1716 Residenzstadt - bildende Kunst, Architektur und Buchdruck fanden hier ein fruchtbares Umfeld, das von den schwarzburgischen Regenten, vor allem durch Anton Günther II. von Schwarzburg-Arnstadt, gezielt gefördert wurde.
Nicht zuletzt widmet sich die Ausstellung schwerpunktmäßig der Historie der Bachkirche in Arnstadt sowie deren 300jähriger Orgelgeschichte. Als herausragendes Exponat präsentiert sich dabei nach wie vor der Spieltisch der Orgel, die der Orgelbauer Johann Friedrich Wender aus Mühlhausen 1703 in der Neuen Kirche fertiggestellt hat und an welchem Johann Sebastian Bach als Organist selbst tätig war.
Bis 21. November 2010:
Günther XLI. Graf von Schwarzburg.
Flämische Tapisserien des 16. Jahrhunderts
Sonderausstellung im Schlossmuseum Arnstadt
Im Bestand des Schlossmuseums Arnstadt befinden sich insgesamt elf flämische Tapisserien des 16. Jahrhunderts, von denen sich sechs archivalisch direkt auf Graf Günther XLI., "den Streitbaren", von Schwarzburg zurückführen lassen und auf das Jahr 1559 datieren.
Es sind dies Objekte, die einen vermeintlichen Gegensatz von Monumentalität und großer Fragilität in sich vereinen. Gerade letzteres führte zu großen Problemen im Bemühen um den Erhalt dieser Exponate, insbesondere in Zeiten musealer Präsentation. Einerseits waren die Entwerfer für die Vorlagen jener Erzeugnisse des Kunsthandwerks bedeutende Künstler ihrer Zeit - und oft sind ihre Vorlagen nur in Form der Tapisserien bis auf die heutige Zeit überhaupt erhalten geblieben -, andererseits dienten die Wandbehänge ganz praktischen Zwecken. Tapisserien einzelner Themenkreise wurden beispielsweise zu ganz bestimmten Anlässen präsentiert. Üblicher Kontext der Repräsentation waren hierbei Krönungen, Empfänge, Hochzeiten, Geburten, Beerdigungen - schlicht Ereignisse, die dem Hofzeremoniell unterworfen waren. Mindestens bis ins 16. Jahrhundert hinein - also auch noch zu Zeiten Graf Günthers XLI. - dienten Tapisserien dem Schmuck provisorischer Unterkünfte, sprich bei Auslandsaufenthalten, Kriegszügen, Besuchen u.ä. Oft wurden demzufolge auch die Themen der Tapisserien in der Raumausstattung gewechselt, niemals hingen also alle Wandbehänge zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Noch aus dem Mittelalter stammte die Gewohnheit, die textilen Behänge nach ihrem Gebrauch wieder zu verstauen - dies nicht zuletzt zu ihrem Schutz.
Die Art und Weise der Präsentation anlässlich der verschiedenen höfischen Ereignisse mag heutigen Betrachtern inorthodox erscheinen. Man scheute nicht davor zurück, die Objekte um die Ecke zu hängen; auch Fenster und Türen waren nicht davor gefeit, zugehängt zu werden. Dies mag einerseits jahreszeitlich bedingt gewesen sein - es ist bekannt, dass es auch eine dämmende Funktion dieser Wandbehänge in den kälteren Jahreszeiten gab -,währenddessen das Zurückschlagen von Tapisserien über Türen, durch Diener bewerkstelligt, auch zeremoniellen Charakter haben konnte.
Unsere Tapisserien dienten ganz offensichtlich der Ausschmückung der zahlreichen Festräume des neuerbauten Schlosses Neideck in Arnstadt. Der Bauherr, Graf Günther, weilte als Jüngling am Nassauer Hof und zeitweilig, im kaiserlichen Dienst stehend, verschiedentlich in den südlichen Niederlanden. 1560 ehelichte er die Gräfin Katharina von Nassau, eine Schwester Wilhelms von Oranien, des späteren Statthalters der nördlichen befreiten niederländischen Provinzen, und weihte das Schloss Neideck mit einer tagelang unter größtem Kosten- und Prachtaufwand gefeierten Hochzeit ein. Archivalisch rekonstruierbar für dieses Residenzschloss sind anhand eines Inventars aus dem Jahre 1583 bis zu 50 Tapisserien - wohl vorzugsweise flämischer Herkunft. Das ist zumindest für Thüringen eine ganz erstaunliche Zahl und an anderen Fürstenhöfen der Zeit im mitteldeutschen Raum so nicht noch einmal nachweisbar. Gezeigt werden dabei Begebenheiten aus dem Alten und Neuen Testament - z.B. widmen sich vier Stücke Szenen aus dem Leben des Heiligen Paulus - sowie zeitgenössische Jagdsujets, die in weltweit einmaliger Weise wie Menschen agierende Affen als Teilnehmer einer Jagdgesellschaft auftreten lassen.
Das Schicksal dieser Tapisserien war in der Folge eng mit dem des Schlosses Neideck verbunden - und wie das Schloss, das im 18. Jahrhundert dem Verfall preis gegeben wurde, verloren die wenigen noch erhalten gebliebenen Tapisserien ebenfalls ihre Wertschätzung. Sie wurden anscheinend geborgen, aber nicht mehr präsentiert und gerieten bald völlig in Vergessenheit.
Die elf Bildteppiche des Arnstädter Museums tauchten schließlich 1860 in einem Hausinventar des Schlosses Gehren auf und gelangten 1930 in den Besitz der Staatlichen Kunstsammlungen Weimar. Von da kamen sie 1949 durch eine Entscheidung des Ministeriums für Volksbildung der Landesregierung Thüringen nach Arnstadt zurück.
Seit 1988 bemüht sich das Schlossmuseum Arnstadt um die Restaurierung dieser Stücke. Im Jahre 2008 konnte dabei der letzte im Zuge dieser Restaurierungsmaßnahmen fertig gestellte Bildteppich aus der Werkstatt der Restauratorin, Frau Gerlach aus Thyrow, im Arnstädter Schlossmuseum in Empfang genommen werden, womit die Vollendung eines 20jährigen (!) Restaurierungsprojektes einher ging.
Im März hat eine Sonderausstellung ihre Tore geöffnet, die bis zum 21. November 2010 alle diese Tapisserien zeigt, ergänzt um Exponate, die das kulturhistorische Umfeld des Arnstädter Hofes zur Zeit Günthers "des Streitbaren" und der Katharina von Nassau erhellen. So brachte Gräfin Katharina beispielsweise aus Antwerpen ein Exemplar der 1569/73 im Auftrag des spanischen Königs Philipp II. bei Plantin gedruckten polyglotten Biblia Regia mit. Nach ihrer "glücklichen Wiederkehr" stiftete sie die acht Bände am 17. Juli 1593 in die Arnstädter Kirchenbibliothek, wo sie noch heute die Reihe der Foliobände eröffnen. "Die Plantinsche Druckerei wurde 1549 von Christophe Plantin (1520-1589) gegründet und befindet sich seit 1576 am Antwerpener Vrijdemarkt. Sie betrieb 16 Pressen und war damit die mit Abstand größte ihrer Zeit in Europa. Über 1500 verschiedene Bücher wurden in Plantins Werkstatt gedruckt; sein Meisterwerk war die achtbändige 'Biblia Regia' oder 'Biblia Polyglotta' in hebräischen, syrischen, aramäischen, griechischen und lateinischen Lettern."
(Zitat aus: Baedeker Belgien 2008, S 162, im Beitrag über Antwerpen)
Das originale Exemplar dieser achtbändigen Plantin-Bibel aus dem Besitz der Katharina von Nassau ist in der Ausstellung genauso zu sehen wie weitere bibliophile Kostbarkeiten aus der Büchersammlung des Grafenpaares.
Wesentlicher Schwerpunkt dieser Sonderausstellung bleibt jedoch die Herstellungs- und Wirkungsweise der flämischen Tapisserien aus dem Bestand des Schlossmuseums Arnstadt, wobei künstlerische Vorlagen und Pendants aus anderen Sammlungen vorgestellt werden. Zugleich soll im Jahre 2010 dem 450. Jubiläum der Prunkhochzeit auf Schloss Neideck in Arnstadt gedacht werden. Unterstützt wird dieses Ausstellungsprojekt durch Leihgaben und Abbildungsbeiträge zahlreicher Museen, Archive und anderer Einrichtungen des In- und Auslandes.
Zur Sonderausstellung ist ein Katalog zum Preis von 25 EUR erschienen, Verlag Vopelius, Jena, 272 Seiten, 127 Abbildungen.
Schlossmuseum Arnstadt
Schlossplatz 1
99310 Arnstadt
Öffnungszeiten
Di.-So. 9.30-16.30 Uhr
Mo. geschlossen
| Aussender: | Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt |
| Ansprechpartner: | Cindy Geyersbach |
| Tel.: | 03628/ 660169 |
| E-Mail: | presse@stadtmarketing.arnstadt.de |